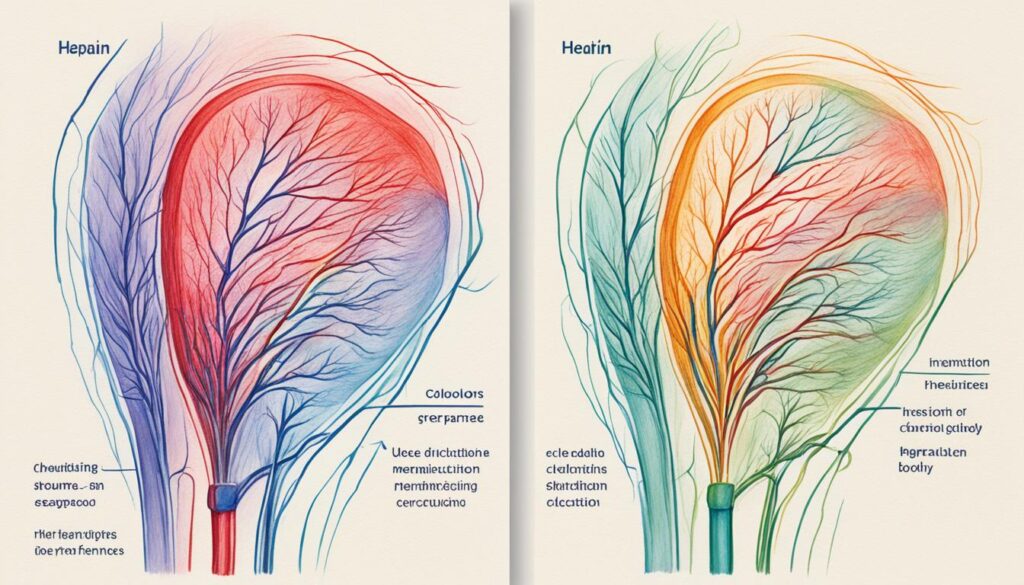Wussten Sie, dass Heparin die Wirksamkeit von Antithrombin um etwa das Tausendfache steigert? Dieses gerinnungshemmende Polysaccherid (Kohlenhydrat) spielt eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle der Blutgerinnung im menschlichen Körper. Heparin wird zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt, die direkt dort in dem Gefäß, wo sie entstehen, einen Verschluss verursachen können (Thrombose) oder mit dem Blut mitgeschwemmt werden und dann an anderer Stelle ein Gefäß verschließen können (Thromboembolie).
Als Antikoagulans ist Heparin ein wichtiger Baustein in der Steuerung der Blutgerinnung. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Wirkungsweise dieses Medikaments, seine Anwendungsgebiete, Formen, Nebenwirkungen und mehr.
- Was ist Heparin?
- Wirkungsweise von Heparin
- Formen von Heparin
- Anwendungsgebiete von Heparin
- Heparin Wirkung und Dosierung
- Verabreichung von Heparin
- Nebenwirkungen von Heparin
- Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen
- Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
- Geschichte und Entdeckung von Heparin
- Fazit
- FAQ
- Quellenverweise
Was ist Heparin?
Heparin ist ein natürlich vorkommendes Glycosaminoglycan und wird als Antikoagulans eingesetzt. Als Medikament wird es zur Prophylaxe und Therapie venöser thromboembolischer Ereignisse und äußerlich bei stumpfen Verletzungen (Schwellungen, Hämatome) angewendet. Heparine werden parenteral verabreicht, da sie aufgrund ihrer negativen Ladung und Größe nicht aus dem Darm resorbiert werden können.
Heparin als Antikoagulans
Heparin ist ein wichtiger Baustein in der Steuerung der Blutgerinnung. Die gerinnungshemmende Heparin-Wirkung besteht darin, dass es die Wirksamkeit von Antithrombin um etwa das Tausendfache steigert. Heparin wird zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt, die direkt dort in dem Gefäß, wo sie entstehen, einen Verschluss verursachen können (Thrombose) oder mit dem Blut mitgeschwemmt werden und dann an anderer Stelle ein Gefäß verschließen können (Thromboembolie).
Herkunft und Gewinnung von Heparin
Heparin wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz großteils aus der Mukosa von Schweinedarm isoliert und gegebenenfalls modifiziert. Die Gewinnung aus Rinderlungen ist seit der BSE-Epidemie obsolet. Früher wurde Heparin erstmals im Jahr 1916 von Jay McLean an der John Hopkins University aus der Leber von Hunden isoliert.
Wirkungsweise von Heparin
Die antikoagulatorische Wirkung aller Heparine beruht auf ihrer Bindung an Antithrombin, einem endogenen Serinprotease-Inhibitor. Die Bindung führt zu einer Konformationsänderung des Antithrombins, welches dann bis zu 1000mal schneller mit seinen Substraten interagiert. Heparine katalysieren die Inaktivierung zahlreicher Gerinnungsfaktoren bzw. Enzyme wie Kallikrein, FXIIa, FXIa, FIXa, FXa und Thrombin. Am bedeutendsten ist hierbei die beschleunigte Hemmung von Thrombin und Faktor FXa.
Antithrombin-Aktivierung
Der wichtigste körpereigene Hemmstoff der Blutgerinnung ist das Protein Antithrombin. Es inaktiviert das Schlüsselenzym Thrombin in der Kaskade des Gerinnungssystems, sodass im Blut gelöstes Fibrinogen nicht zum festen Fibrin verklumpen kann. Die gerinnungshemmende Heparin-Wirkung besteht darin, dass es die Wirksamkeit von Antithrombin um etwa das Tausendfache steigert.
Hemmung von Gerinnungsfaktoren
Heparine wirken weiterhin antiinflammatorisch, komplementhemmend, inhibierend auf die Tumormetastasierung und antiangiogenetisch. Im Gegensatz zum hochmolekularen Heparin wirkt das fraktionierte, niedermolekulare Heparin (NMH oder LMWH) vor allem durch die Blockade des aktivierten Gerinnungsfaktors X (FXa).
Formen von Heparin
Es gibt verschiedene Formen von Heparin, die sich in ihrer molekularen Struktur und Wirkungsweise unterscheiden. Grundsätzlich lassen sich zwei Hauptgruppen differenzieren: Hochmolekulare oder unfraktionierte Heparine und fraktionierte, niedermolekulare Heparine.
Unfraktioniertes (hochmolekulares) Heparin
Hochmolekulare oder unfraktionierte Heparine (UFH) werden aus tierischen Geweben, insbesondere der Schweinedarmmukosa, gewonnen und haben eine durchschnittliche Molekülmasse von 16 kDa. Die Therapie mit hochmolekularen Heparinen muss durch die regelmäßige Bestimmung der Gerinnungswerte (z.B. PTT) im Blut engmaschig überwacht werden. Aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit muss unfraktioniertes Heparin zur Therapie kontinuierlich intravenös über ein Perfusorsystem verabreicht werden.
Fraktioniertes (niedermolekulares) Heparin
Im Gegensatz zum hochmolekularen Heparin wird fraktioniertes, niedermolekulares Heparin (NMH oder LMWH) nach der Isolation aus Gewebe auf ein durchschnittliches Molekulargewicht von etwa 5 kDa herunterfraktioniert. Es wirkt als Bruchstück vor allem durch die Blockade des aktivierten Gerinnungsfaktors X (FXa). Im Gegensatz zu den hochmolekularen Heparinen muss eine Therapie mit niedermolekularem Heparin nicht engmaschig überwacht werden.
Anwendungsgebiete von Heparin
Heparin wird zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt, die direkt dort in dem Gefäß, wo sie entstehen, einen Verschluss verursachen können (Thrombose) oder mit dem Blut mitgeschwemmt werden und dann an anderer Stelle ein Gefäß verschließen können (Thromboembolie).
Thromboseprophylaxe
Niedrige Heparin-Dosen nutzt man zur Thromboseprophylaxe vor und nach einer Operation, bei Verletzungen sowie bei längerer Bettlägerigkeit.
Therapie bei Thrombosen und Embolien
Hochdosierte Heparin-Präparate finden Anwendung bei venösen Thrombosen (Blutpfropfen in einer Vene) sowie beim akuten Koronarsyndrom (instabile Angina pectoris oder akuter Herzinfarkt). Heparin wird auch zur Vorbeugung (Prophylaxe) von Thrombosen bei extrakorporalen Kreislauf (Herz-Lungen-Maschine) oder Dialyse eingesetzt.
Weitere Einsatzgebiete
Neben der Thromboseprophylaxe und -therapie wird Heparin auch lokal auf der Haut angewendet, etwa bei Verletzungen wie Prellungen und Blutergüssen, wo es abschwellend wirkt.
Heparin Wirkung und Dosierung
Die Dosierung von Heparin-Präparaten wird in Internationalen Einheiten (I.E.) angegeben. Je mehr I.E. ein Präparat enthält, desto stärker und länger hält die Heparin-Wirkung an. In medizinischen Notfällen wie einem Herzinfarkt müssen sofort parenterales Heparin (2-3 mal 7.500 I.E.) und Acetylsalicylsäure (ASS) gegeben werden. Um einer Thromboembolie vorzubeugen, werden danach alle acht bis zwölf Stunden subkutan 5.000 bis 7.000 I.E. unfraktioniertes Heparin verabreicht.
| Anwendung | Dosierung |
|---|---|
| Notfall bei Herzinfarkt | 2-3 mal 7.500 I.E. Heparin parenteral |
| Thromboseprophylaxe | Alle 8-12 Stunden 5.000-7.000 I.E. Heparin subkutan |
Die Dosierung von Heparin-Präparaten ist entscheidend für die Stärke und Dauer der Heparin-Wirkung. In Notfällen wie einem Herzinfarkt müssen hohe Dosen Heparin und Acetylsalicylsäure verabreicht werden, während zur Thromboseprophylaxe regelmäßig niedrigere Dosen Heparin subkutan appliziert werden.
https://www.youtube.com/watch?v=rCiNrt0RXs0
Verabreichung von Heparin
Heparin kann intravenös oder subkutan injiziert werden. Aufgrund der kurzen biologischen Halbwertszeit von etwa einer Stunde muss Heparin häufig oder als kontinuierliche Infusion verabreicht werden. Fraktioniertes, niedermolekulares Heparin (NMH) hat eine Halbwertszeit von 3 bis 5 Stunden und ermöglicht eine einmal tägliche Anwendung.
Parenterale Gabe
Heparin kann intravenös oder subkutan injiziert werden. Aufgrund der kurzen biologischen Halbwertszeit von etwa einer Stunde muss Heparin häufig oder als kontinuierliche Infusion verabreicht werden. Fraktioniertes, niedermolekulares Heparin (NMH) hat eine Halbwertszeit von 3 bis 5 Stunden und ermöglicht eine einmal tägliche Anwendung.
Lokale Anwendung
Heparin kann auch lokal auf der Haut in Form von Gelen, Cremes oder Salben angewendet werden, etwa bei Verletzungen wie Prellungen und Blutergüssen. Aufgrund der Molekülgröße der Heparine sowie ihrer negativen Ladung ist es jedoch fraglich, ob der Wirkstoff über die Haut aufgenommen werden kann.
Nebenwirkungen von Heparin
Die häufigste Heparin-Nebenwirkung sind unerwünschte Blutungen. Bei starken Blutungen muss die Heparin-Wirkung aufgehoben werden, wozu Protamin verwendet wird, welches das Heparin neutralisiert.
Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)
Eine weitere häufig beschriebene Nebenwirkung ist die Heparin induzierte Thrombozytopenie (kurz: HIT). Dabei kommt es zur Bildung von Antikörpern gegen Heparin, was zu schweren Gerinnselbildungen führen kann. Das Risiko für eine HIT Typ II ist bei unfraktioniertem (hochmolekularem) Heparin größer als bei fraktioniertem (niedermolekularem) Heparin.
Weitere Nebenwirkungen
Neben Blutungen sind auch allergische Reaktionen, reversibler Haarausfall und ein Anstieg der Leberenzyme mögliche Nebenwirkungen von Heparin.
Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen
Bei der Anwendung von Heparin müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Heparin wird nicht oder nur sehr niedrig dosiert verabreicht bei schweren Leber- und Nierenerkrankungen. Auch bei chronischem Alkoholismus ist Vorsicht geboten.
Blutungsrisiken
Heparin darf nicht angewendet werden bei aktueller oder aus der Anamnese bekannter allergisch bedingter Thrombozytopenie auf Heparin, aktiver starker Blutung und Risikofaktoren für eine starke Blutung. Die häufigste Heparin-Nebenwirkung sind unerwünschte Blutungen, die bei Auftreten umgehend behandelt werden müssen.
Schwangerschaft und Stillzeit
Heparin ist nicht plazentagängig und kann daher während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Zur Prophylaxe und Therapie von thromboembolischen Ereignissen während der Schwangerschaft sollten jedoch bevorzugt niedermolekulare Heparine angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
Bei der Anwendung von Heparinen kann es bei gleichzeitiger Anwendung zu Wechselwirkungen kommen mit Arzneimitteln mit Wirkung auf die Hämostase, systemischen Salicylaten, Acetylsalicylsäure, NSAR, anderen Thrombolytika und Antikoagulanzien, Arzneimitteln, die den Kaliumspiegel erhöhen, Zytostatika, Nitroglycerin sowie mit Arzneimitteln, die an Plasmaproteine gebunden sind und mit basischen Arzneimitteln.
| Arzneimittelgruppe | Mögliche Interaktion mit Heparin |
|---|---|
| Arzneimittel mit Wirkung auf die Hämostase | Verstärkte Antikoagulation und erhöhtes Blutungsrisiko |
| Systemische Salicylate, Acetylsalicylsäure, NSAR | Verstärkte Antikoagulation und erhöhtes Blutungsrisiko |
| Andere Thrombolytika und Antikoagulanzien | Verstärkte Antikoagulation und erhöhtes Blutungsrisiko |
| Arzneimittel, die den Kaliumspiegel erhöhen | Erhöhtes Risiko für Hyperkaliämie |
| Zytostatika | Verstärkte Wirkung der Zytostatika |
| Nitroglycerin | Verstärkte Wirkung des Nitroglyzerins |
| Arzneimittel, die an Plasmaproteine gebunden sind | Verdrängung der Bindung an Plasmaproteine |
| Basische Arzneimittel | Verstärkte Wirkung der basischen Arzneimittel |
Bei Anwendung von Heparin sollten diese möglichen Arzneimittelwechselwirkungen sorgfältig berücksichtigt werden, um Komplikationen zu vermeiden.
Geschichte und Entdeckung von Heparin
Im Jahr 1916 wurde Heparin von Jay McLean an der John Hopkins University entdeckt – der Mediziner hatte es aus der Leber von Hunden isoliert. Heute wird Heparin aus Schweinedarmschleimhaut oder Rinderlunge gewonnen, nachdem die Gewinnung aus Rinderlungen seit der BSE-Epidemie obsolet ist.
| Jahr | Entdeckung | Herkunft |
|---|---|---|
| 1916 | Jay McLean an der John Hopkins University | Hunde-Leber |
| Heute | – | Schweinedarmschleimhaut oder Rinderlunge |
Die Entdeckung von Heparin durch Jay McLean im Jahr 1916 markierte einen wichtigen Meilenstein in der Medizingeschichte. Seitdem hat sich die Gewinnung und Anwendung des Gerinnungshemmers ständig weiterentwickelt, um den Bedarf an sicheren und effektiven Antikoagulanzien zu decken.
Fazit
Heparin ist ein wichtiges Antikoagulans, das in verschiedenen Formen zur Prophylaxe und Therapie von Thrombosen und Embolien eingesetzt wird. Während hochmolekulares Heparin eine engmaschige Überwachung erfordert, bietet das fraktionierte, niedermolekulare Heparin Vorteile wie eine einfachere Handhabung und ein geringeres Risiko für Komplikationen wie die Heparin-induzierte Thrombozytopenie.
Die Anwendung von Heparin erfordert aufgrund möglicher Nebenwirkungen und Wechselwirkungen ärztliche Überwachung. Ärzte müssen die Dosis sorgfältig anpassen und den Behandlungsverlauf engmaschig kontrollieren, um Komplikationen wie schwere Blutungen oder Thrombosen zu vermeiden.
Insgesamt ist Heparin ein wichtiges und weit verbreitetes Medikament zur Behandlung und Vorbeugung von Gerinnungsstörungen. Mit der richtigen Dosierung und ärztlicher Begleitung kann es seine volle Wirksamkeit entfalten und den Patienten erheblich unterstützen.