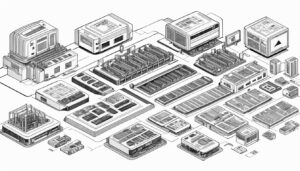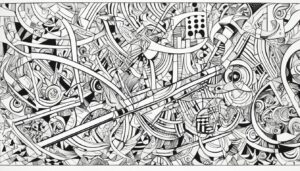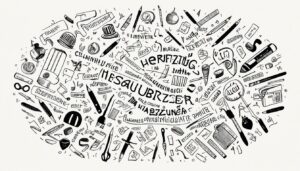Tipps und Tricks um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln
Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist ein fortlaufender Prozess, der uns ermöglicht, unser volles Potenzial zu entfalten und ein zufriedenstellenderes …
Gummibärchen zum Abnehmen: Figurfreundlicher Genuss
Gummibärchen sind eine beliebte Nascherei, die vielen Menschen Freude bereitet. Doch wussten Sie, dass Gummibärchen auch beim Abnehmen helfen können? …
Beliebte Artikel
Bei Business And Science finden Sie professionelle Ghostwriter, mit denen Hilfe Sie eine Bachelorarbeit schreiben lassen können.